
Die ePA in der hausärztlich-internistischen Versorgung

„Wir haben eine kontinuierliche Weiterentwicklung gespürt. Es hat richtig Spaß gemacht, das zu sehen“, sagt ePA-Pionierin Karina Pate. Sie ist hausärztlich tätige Internistin in einer hausärztlichen Gemeinschaftspraxis in Dortmund und sammelt schon seit der Testphase Erfahrungen mit der elektronischen Patientenakte. „Wir haben uns freiwillig als Testpraxis zur Verfügung gestellt, denn wir wollten diesen Prozess aktiv mitgestalten“, sagt Pate. „Anfangs war es etwas holprig. Aber damit hatten wir gerechnet.“ So konnte die ePA zunächst nur in der Stammpraxis genutzt werden, nicht aber in der Zweigstelle, die über einen VPN-Zugang mit dem Server der Hauptpraxis verbunden ist. Letztendlich fehlte jedoch nur die Freigabe der Betriebsstättennummer (BSNR) der Zweigstelle durch den Anbieter ihres Praxisverwaltungssystems Medatixx. Nachdem diese Lücke im Prozess behoben werden konnte, läuft die ePA in Pates Praxis an beiden Standorten. Und Medatixx schalte regelmäßig ePA-Updates mit neuen Funktionen frei, ergänzt sie aus der täglichen Arbeit.
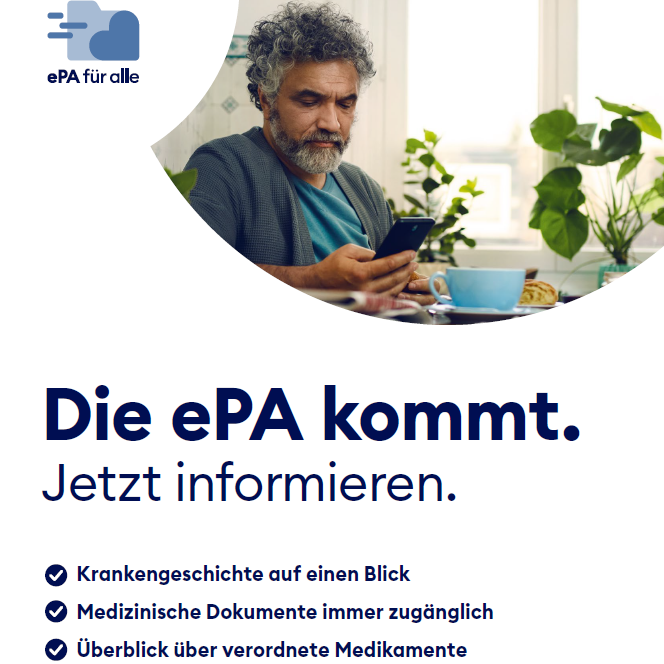
Nutzen und Nutzung
Die meisten Patientinnen und Patienten in ihrer Praxis haben eine ePA, nur sehr wenige haben widersprochen. Die Aufklärung über das neue Angebot erfolgt in der Dortmunder Gemeinschaftspraxis über ein Wartezimmerplakat, das Wartezimmer-TV und mündlich. Pates Erfahrung: „Die Patientinnen und Patienten nehmen die ePA sehr gut an. Sie sind erleichtert, dass sie nicht mehr alles in die Sprechstunde mitbringen müssen.“
Die ePA bietet zum Start eine elektronische Medikationsliste. Darin sind alle verordneten Medikamente der Patientin bzw. des Patienten aus allen Arztpraxen aufgelistet; auch aus denen, die nicht an den Tests teilgenommen haben. Für Karina Pate ein Gewinn, wie sie im Mai im Gespräch mit der gematik feststellte: „Wir erleben die ePA dank der Medikationsliste schon jetzt als großen Vorteil. Sehr viele Patientinnen und Patienten kommen ohne jede Informationen und Kenntnisse, was sie einnehmen. Da hilft die Anzeige, aus welcher Apotheke das Medikament abgeholt wurde, enorm. So sehe ich erstens, ob die Medikation überhaupt abgeholt wurde, und zweitens, ob es gegebenenfalls Doppelverordnungen bei bestimmten Medikamenten gibt, z. B. bei GLP 1 Analoga, also den so genannten Abnehmspritzen.“

Integration ins Primärsystem
Die Liste generiert sich in Pates Primärsystem selbständig beim Verschreiben der Medikamente ohne eine weitere Aktion der Arztpraxis. Das Hochladen geschieht automatisch beim Speichern des Medikationsplans, z. B. nach Änderungen. Hat das anfangs etwa vier Sekunden gedauert, benötigt die Aktualisierung seit Freigabe der ePA für alle Einrichtungen seit Ende April ihrer Schätzung nach eher 30 Sekunden.
Pate und ihre Kolleginnen und Kollegen können außerdem den Notfalldatensatz über strukturierte Dokumente sowie Laborwerte durch Anklicken in die ePA hochladen. KIM-Briefe werden ebenso automatisch hochgeladen, auch Änderungen.
Aktuell sieht die Internistin in der ePA Dokumente (strukturierte, Sonstige, Archiv), die elektronische Medikationsliste, den elektronischen Medikationsplan, den eArztbrief, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und den Notfalldatensatz. Die Krankenkasse stellt am Quartalsanfang die Abrechnungsdaten ein. Den Datensatz Persönliche Erklärungen muss eine Patientin oder ein Patient selbst einstellen, einen Reiter gibt es im Menü aber schon.
Keine ePA ist größeres Sicherheitsrisiko

Von so viel Automatismus ist Dr. med. Hendrik Bachmann mit seinem Praxisverwaltungssystem (PVS) – ebenfalls aus dem Hause Medatixx – noch etwas entfernt. Er hat festgestellt, dass sich die Funktionalitäten der ePA und ihre Nutzbarkeit stark vom PVS und der Zuarbeit des Herstellers unterscheiden.
So ist in seinem System das Hochladen bzw. die Eingabe von Inhalten in die ePA händisch bzw. selbständig notwendig, beispielsweise von erstellten Arztbriefen oder Metadaten. Labordaten werden nicht automatisch erfasst, sondern müssen virtuell hochgeladen, in ein pdf umgewandelt und dann in die ePA hochgeladen werden. Im Praxisalltag ist das umständlich.
Der Internist und Kardiologe ist im MVZ Ärztliches Praxiszentrum obere Königsstraße in Bamberg tätig. Er bezeichnet sich selbst als „begeisterten Anhänger der ePA“. Insofern konnte er die Testphase in der Modellregion Franken, an dem er teilgenommen hat, kaum erwarten. Denn er ist von einem notwendigen Wandel überzeugt: „Bislang und immer noch herrscht in der medizinischen Versorgung hierzulande eine ,Rauchzeichenkommunikation‘ vor.“ Damit meint Bachmann Briefe, Faxe, Anrufe und Überweisungsscheine. Für ihn ist Deutschland „Benkenweltmeister“, dabei sei, so seine These, „keine ePA das größere Sicherheitsrisiko für Patientinnen und Patienten“.
Die ePA mit Leben füllen

Dr. Georg Fröhlich ist niedergelassener hausärztlicher Internist und Diabetologe in einer landärztlichen Allgemeinpraxis im Westerwald. Die ePA-Einführung in der Praxis verlief schrittweise – zunächst haben die drei Ärzte die Arbeit damit übernommen, nun folgt schrittweise das Praxispersonal.
Er sieht viele Vorteile: „Es ist eine patientengeführte Akte. Der Patient oder die Patienten hat vollen Zugriff auf seine bzw. ihre Akte und kann den Zugriff einschränken oder auch erweitern.“ Er sieht die ePA als Abbild der Behandlung im Alltag. Viele Ärztinnen und Ärzte könnten darüber miteinander einen Patienten bzw. eine Patientin gemeinsam behandeln. „Barrieren können reduziert werden, Doppeluntersuchungen vermieden, Patientinnen und Patienten zielgenauer untersucht und begleitet werden“, fasst Fröhlich zusammen. Nur durch die systematisch hochgeladenen Informationen könne die ePA mit Leben gefüllt werden.
Mit einem vorliegenden Medikationsplan in der ePA gelingt es uns, sofort und unmittelbar aus dem Übergang zum Beispiel vom stationären in den ambulanten Rahmen Therapie fortzuführen und zu adaptieren.“
Ein besserer Überblick für eine bessere Behandlung
Internistin Karina Pate erwartet noch mehr Nutzen und Problemlösungen dank der Informationen, die Mitbehandlerinnen und Mitbehandler zunehmend in die ePA einstellen. „Dann werden wir immer weniger Patientinnen und Patienten bei uns haben, zu denen uns initial Informationen für die aktuelle Behandlung fehlen.“ Das werde beispielsweise auch die Krankenhaus-Entlassung erleichtern. Die drei hausärztlichen Internist:innen freuen sich, wenn künftig noch mehr Kliniken und andere Versorgungszweige mit an Bord sind, z. B. Pflege oder Physiotherapie. Wie Georg Fröhlich zusammenfasst: „So gelingt ein besserer Überblick und somit auch eine bessere Behandlung.“
Stand: Juni 2025


